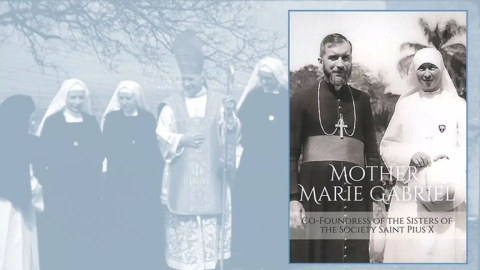Der hl. Klemens Maria Hofbauer als Seelsorger (1)

Infolge umfangreicher Wartungsarbeiten an unserer Webseite, die einen längeren Zeitraum in Anspruch nahmen, können wir erst jetzt mit den Berichten über das Wirken des hl. Klemens Maria Hofbauer während seiner letzten Lebensjahre in Wien fortsetzen.
Die Hauptstätte des seelsorgerlichen Wirkens unseres Heiligen in den letzten Jahren seines Lebens war nicht mehr die Kanzel wie früher, sondern der Beichtstuhl. Im Durchschnitt mag ein Drittel seines gewöhnlichen Tagewerkes auf die Gewissensleitung entfallen sein. So stark wurde er allmählich in Anspruch genommen. Personen aller Stände suchten ihn auf; sagte er doch selbst, außer einem Papst und einem Kaiser habe er Menschen aller Gattungen zur Beichte gehabt. Oft noch des Abends, wenn er im Kreise seiner Studenten saß, kam ein Herr, der um die Beichte bat. Er war aber auch ein Beichtvater von außergewöhnlichen Eigenschaften. Alfons von Klinkowström vergleicht ihn als Seelenarzt mit dem großen Wiener Pathologen Dr. Oppolzer, einem der genialsten Diagnostiker seiner Zeit. Der Hofbauer angeborene instinktive Scharfblick für die Geheimnisse des Menschenherzens muss sich in jahrzehntelanger Ausübung der Seelenführung stetig vervollkommnet haben. Seine Beichtkinder hatten das beruhigende Bewusstsein, in der Hand eines solchen Seelenarztes vollkommen geborgen zu sein. Dafür bürgte die Gründlichkeit, mit der er seines Amtes waltete. Wenn es der Seelenzustand erforderte und die Umstände es einigermaßen erlaubten, ließ er der Lebensbeichte, auf die er immer große Stücke hielt, eine sorgfältige Vorbereitung vorausgehen.
Einmal bat ihn unmittelbar nach der Predigt ein junger, verwahrloster Mann um die Beichte. Hofbauer fasste ihn an der Hand, blickte ihm scharf ins Gesicht und sagte nur: „Noch nicht. Kommen Sie mit!“ und nahm ihn auf einige Tage zu sich in die Wohnung. Hier sollte er sich in stiller Zurückgezogenheit auf die große Lebensrechnung vorbereiten. An der Wand des ihm zugewiesenen Zimmers hing ein ergreifend rührendes Bild: Jesus an der Geißelsäule. Hofbauer wies den verlorenen Sohn hinauf: „Franz, da lern jetzt deine Lektion!“ Franz schaute auf eine bunte Vergangenheit zurück. Sein Heldenzeitalter in den Straßen Wiens hatte der Wildfang mit der Flucht aus dem Elternhaus abgeschlossen. Dann ging er zum Militär, desertierte und kam schließlich nach Paris, wo es ihn auch nicht lange litt. In gänzlich herabgekommenen Zustand kehrte er nach Wien zurück. Er wagte es aber nicht, seiner Mutter, einer überaus derben Frau, unter die Augen zu treten. Ein guter Engel führte den Herumirrenden eines Tages nach St. Ursula. Hofbauer stand eben auf der Kanzel und predigte von den Qualen eines bösen Gewissens. Am meisten graute dem jungen Mann vor dem Wiedersehen mit der Mutter. Doch Hofbauer versprach ihm, dass alles gut gehen werde. Die gute Frau war nicht wenig erstaunt, als sie eines Tages von Hofbauer zum Frühstück gebeten wurde. Er lenkte das Gespräch auf ihre Kinder und ließ sich von ihnen erzählen. Den Franz überging sie mit Stillschweigen. Als sie nun der Heilige direkt über diesen befragte, sagte sie voll Bitterkeit, der sei schon lange gehängt. Hofbauer meinte lächelnd so schnell werde es mit dem Hängen doch nicht gehen, stand auf und öffnete die Türe. Weinend stürzte Franz der Mutter zu Füßen. Die gekränkte Frau hub mit einer gewaltigen Strafpredigt an; doch Hofbauer schnitt ihr bald das Wort ab: „Nun ist´s genug. Jetzt nehmt miteinander das Frühstück!“ Die schwere Stunde war glücklich vorüber. Noch etwas hatte Franz zu bereinigen. Im Hofe der Salesianerinnen, denen seine Mutter täglich die Milch brachte, hatte er manchen Unfug getrieben. Hofbauer kündigte der Oberin des Klosters eines Tages an, er werde ihr morgen einen Augustinus bringen. Die Oberin verstand dies von einem Bilde und lehnte dankend ab, da sie schon versorgt seien. Doch der Heilige kam mit einem lebenden Augustinus, der die Oberin demütig für die Untaten seiner Knabenzeit um Verzeihung bat. Jetzt war das Werk der Versöhnung mit Gott und den Menschen beendet. Franz wollte sich aber von seinem Retter nicht mehr trennen. Er bat ihn um die Aufnahme in die Kongregation und setze die Studien wieder fort. Es ist der uns schon bekannte Franz Hätscher, den Hofbauer im Herbst 1815 mit Forthuber und Libozky in die Walachei entsandte. Als Missionär nahm Hätscher sein Wanderleben wieder auf, aber jetzt im Dienste Gottes und der Seelen. Nicht nur in der Walachei, in verschiedenen Ländern Österreichs und in England wirkte er; auch bei den Indianern Nordamerikas verkündete er das Wort Gottes. Hochbetagt starb Hätscher im Redemptoristenkolleg zu Leoben in der Steiermark.
Freilich war es dem Heiligen nicht immer möglich, in so umfassender Weise für ein verlorenes Schäflein Sorge zu tragen. Doch ist das von Hätscher Erzählte kein vereinzelter Ausnahmefall. Den in die Irre geratenen Seelen nachzugehen, das betrachtete er als seine eigentliche Aufgabe. Ein Maler hat ihn unter dem Bilde des guten Hirten dargestellt, wie er, müde auf den Wanderstab sich stützend, das lang gesuchte Schäflein heimwärts trägt. Das ist der beste Ausdruck seines Wiener Apostolates. Es ist merkwürdig, welch scharfen Blick der Heilige für seelische Nöten der Menschen hatte. Seine Freunde sagten doch von ihm, er schaue immer nach innen. Wenn er aber so gesammelt seines Weges ging, so wusste er ein besonders bedrängtes Menschenkind selbst aus dem Straßengewühl herauszufinden. Da schlenderte einmal ein eben aus der Schule davongejagter Knabe in erbärmlicher Stimmung durch die Straßen dahin. In der Johannesgasse begegnete er zufällig dem Heiligen, der ihm sogleich zurief: „Buberl komm her, dir fehlt was!“ Und ohne viel Umstände zu machen führte er den Knaben zu sich aufs Zimmer, ließ sich die kleine Leidensgeschichte erzählen und richtete dem Kind Kopf und Herz wieder zurecht. Franz Haubner, so hieß der Junge, wurde ein edler Mensch und ein vortrefflicher Katholik.
Einen Mann, der eben in der Donau den Tod suchen wollte, rettete Hofbauer noch in letzter Stunde. Durch das freundliche Angebot einer Prise Tabak zog er den Armen ins Gespräch und brachte ihn bald auf andere Gedanken und auf bessere Wege. Ein ähnlicher Fall dieser Art ereignete sich zur Zeit des großen Staatsbankrotts, durch den viele Wohlhabende über Nacht in dürftige Verhältnisse gestürzt wurden. Hofbauer wandelte eines Tages mit einem Freund das Donauufer entlang. Ohne sich zu entschuldigen, riss er sich plötzlich von der Unterhaltung los, und raschen Schrittes ging er auf eine Dame zu, die sich langsam und zögernd der Donau näherte. Mit seinem scharfen Blick hatte er ihr Vorhaben durchschaut, Es war Fräulein Babette N. Bisher hatte sie von ihrem Vermögen in den angenehmsten Verhältnissen gelebt; durch den Geldsturz war sie arm geworden. Sehr weltlich gesinnt, eitel und ohne Religion, fand sie nicht die Seelenstärke, sich in die dürftigen Verhältnisse zu fügen, in die sie sich plötzlich gestellt sah. Sie beschloss, ihrem Leben in der Donau ein Ende zu bereiten. Ohne viel Umschweife stellte sie Hofbauer darüber zur Rede. Sie gestand ihr Vorhaben offen ein und schilderte ihre Lage. Da bückte er sich, nahm eine Handvoll Erde in die Hand und hielt sie ihr vor die Augen; „Was ist das Geld? Eine Handvoll Staub!“ Es gelang ihm, sie zu bewegen, mit ihm in die Stadt zurückzukehren, wo er ihr in einem Zinshaus der Ursulinen eine Wohnung verschaffte. In den folgenden Tagen nahm er ihre Lebensbeichte entgegen. Die innere Umwandlung der armen Person war gründlich und hielt das ganze weitere Leben an. Hofbauer selbst nannte sie eine heilige Büßerin. Noch jahrelang blieb sie in den Kirchen Wiens eine typische Erscheinung. Nach ihrem bescheidenen schwarzen Anzug hieß sie im Volksmund die „schwarze Babette“. Ihre wohlhabendere Schwester, Regierungsrätin A., bot ihr später die Aufnahme in ihre Familie an. Babette wies den Antrag zurück: sie habe Besseres kennengelernt, und dabei bleibe sie. Sie beschloss ihr heiligmäßiges Leben als Pensionärin im Spital der Elisabethinen in Wien.
- wird fortgesetzt -
Quelle: Der heilige Klemens Maria Hofbauer - Ein Lebensbild von Johannes Hofer